
„Wo willst Du denn schon wieder hin?“ Die Stimme meiner Mutter hatte mich eingefangen, bevor ich aus der Wohnung entwischen konnte. – „Zum Hieroldstand“, erwiderte ich kleinlaut, als hätte mich Mama bei einer Untat erwischt. Gerade hatte ich aus der Tiefe der Hosentasche meiner Krachledernen ganz unerwartet ein Fünfzigpfennigstück gegraben. Ein Geschenk des Himmels. Ein Geschenk, das es sofort in Süßigkeiten umzusetzen galt. Natürlich im Eckladen von Frau Hierold, zwei Straßenecken weiter, dort wo der Münchener Stadtteil Laim schon in den dörflichen Randbezirk Kleinhadern übergegangen war.
Meine Freundin, die Maria, würde nicht schlecht staunen. Fünfzig Pfennig! Dafür gab es eine Tüte mit zehn Brausestangen. Oder zwei Gummihalsketten mit Brauseperlen, eine für jeden von uns. Oder fünf Mohrenköpfe. Oder eine Domino-Eiswaffel und sogar Rückgeld! – (Man beachte bitte, dass wir uns damals in der Prä-Ü-Ei-Zeitrechnung befanden.)
Frau Hierold, eine weißhaarige Matrone, führte im Erdgeschoß eines Einfamilienhauses an der Straßenecke einen Tante-Emma-Laden, in dem sie alle Artikel des täglichen Bedarfs verkaufte. Für Sechsjährige wie mich bestand der tägliche Bedarf logischer Weise in erster Linie aus Naschzeug. Wir liefen durch den Vorgarten des Ladens zu einem Fenster, das im Sommer immer offen stand, stiegen auf einen Holzschemel unter dem Fensterbrett und beäugten diverse Glasgefäße mit Schraubverschlüssen, in denen sich unsere Zuckerträume befanden.
Schon als Erstklässler hatten wir das Kopfrechnen so weit im Griff, dass wir wussten, wie viele Brausestangen wir für die paar Groschen bekamen, die wir einstecken hatten. Aber notfalls drückte Frau Hierold an ihrem Verkaufsstand schon mal ein Auge zu und rundete zu Gunsten ihrer Kinderkundschaft großzügig auf. Wir tauschten unsere Pfennigbeträge gegen Papiertütchen, in die die Hierold alle Objekte unserer Begierde steckte, und zogen beglückt von dannen.
Für erwachsenen Kunden gab es eine Tür, die in einen kleinen Verkaufsraum führte, in dem in deckenhohen Regalen alles aufgereiht war, was Haushalte so brauchten: Toilettenpapier in Einzelrollen, Seifebarren, Bier- und Weinflaschen, Zeitungen und Zeitschriften …
Im Hintergrund des Raumes regierte Frau Hierold hinter einer Theke, schnitt Wurst und Käse auf oder bediente die Kundschaft durch das Fenster in den Vorgarten.
„Wenn Du zur Hierold gehst, bring bitte ein halbes Pfund Butter und fuffzig Gramm Aufschnitt mit, Putzi. Und eine Feinstrumpfhose. Hier haste zehn Mark, und vergiss das Wechselgeld nicht.“ Mein Mutter drückte mir zwei Fünfer in die Hand und schob mich aus der Tür.
Die Sache mit der Feinstrumpfhose musste Mama mir nicht genauer erklären. Frau Hierold kannte die Leute aus der Gegend. Und wenn der kleine Wortmischer bei ihr auftauchte und nach einer Strumpfhose für Mama verlangte, wusste sie, dass sie mir Fleischfarbene in der Konfektionsgröße 38-40 mitgeben musste. – Und obwohl ich damals nicht älter als sechs war, gab sie mir auch anstandslos zwei Flaschen Paulaner hell mit, wenn ich danach fragte. Bier für den Papa. Dafür brauchte Putzi keinen Altersnachweis.
~
Anfang der Siebzigerjahre war der Hieroldstand eines Tages geschlossen. Hinter dem Fensterglas hing ein handgeschriebenes Schild, noch in Sütterlin: „Geschäftsaufgabe“. Kinder hinterfragen so etwas ja nicht unbedingt. Wir gingen dann eben achselzuckend in den Supermarkt, der ein paar Straßen weiter aufgemacht hatte. Und die Strumphosen musste Mama sich eben selbst besorgen.
[lightgrey_box]Die Grafik da oben habe ich beim Nachbarn Trithemius geborgt, der dazu auffordert, in den Erinnerungen zu kramen und sich an seinem Erzählprojekt zu beteiligen. Was ich hiermit sehr gern getan habe. (Hier geht es lang zur Liste aller Projektteilnehmer.)[/lightgrey_box]
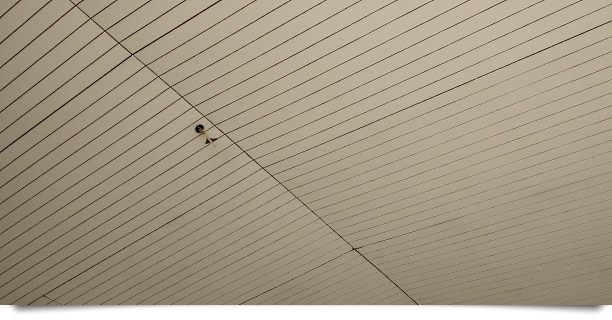





 Und zu allem Überfluss soll nun auch noch der bislang hier nicht wahrnehmbare Hochsommer auf ein paar Tage zurückkehren? Vielleicht mausert sich das Jahr 2016 ja doch noch? Wir werden sehen, meine Fliegenpatsche und ich …
Und zu allem Überfluss soll nun auch noch der bislang hier nicht wahrnehmbare Hochsommer auf ein paar Tage zurückkehren? Vielleicht mausert sich das Jahr 2016 ja doch noch? Wir werden sehen, meine Fliegenpatsche und ich …